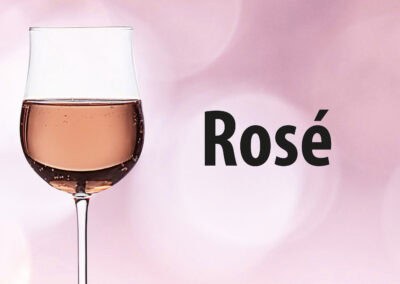Wenn Wein zum Überfluss wird
Rom, ein spätsommerlicher Morgen, und im ehrwürdigen Agrarministerium riecht es nach Aufbruch – und leiser Beklemmung. Am 10. September verkündete Italien seine Ernteprognose: 47,4 Millionen Hektoliter. Ein Plus von acht Prozent gegenüber 2024, über den Fünfjahresmittelwert nur um zwei Prozent hinaus – und doch ein Paukenschlag. Italien bleibt Europas mengenstärkstes Weinland, der Abstand zu Frankreich (37,4 Mio. hl) und Spanien (36,8 Mio. hl) wächst merklich.
Die Zahlen wirken wie ein Triumph, wären da nicht die Gesetze des Marktes. „Wir stoßen auf einen qualitativ hervorragenden Jahrgang an, aber nicht auf die Mengen“, mahnt Lamberto Frescobaldi, Präsident der Unione Italiana Vini. Hinter der poetischen Metapher vom „Akkordeonsystem“, das sich je nach Bedarf weiten und schließen könne, steht nackte Sorge: Über 37 Millionen Hektoliter lagern noch in den Kellern, das Preisniveau wankt. Zu viel Wein entwertet selbst den Besten.
Vom Wetter verwöhnt, vom Markt gezähmt
Dabei glänzt der Jahrgang. Gesunde Trauben, aromatische Frische, stabile Wasserreserven aus einem feuchten Winter – der Norden darf sich auf elegante, langlebige Weine freuen, Mittelitalien auf ausgewogene Profile, der Süden auf kraftvolle Rotweine. Die Lese begann mancherorts früh, zieht sich jedoch im Süden in die Länge.
Quantitativ treibt Süditalien das Land an die Spitze: plus 19 Prozent, Apulien allein meldet 17 Prozent Zuwachs auf neun Millionen Hektoliter. Im Norden erholt sich die Lombardei (+15 %), das Friaul wächst um zehn, Trentino-Südtirol um neun Prozent. Mittelitalien dagegen schwächelt, vor allem die Toskana mit minus 13 Prozent nach einem üppigen Vorjahr. Unangefochten führt Venetien das Ranking an – fast zwölf Millionen Hektoliter, ein Viertel der Gesamtproduktion.
Märkte unter Spannung
Der Weinmarkt indes zeigt Risse. Der ISMEA-Erzeugerpreisindex stieg 2024/25 um nur ein Prozent. Weiße Basisweine legten leicht zu, DOC- und DOCG-Weine verloren, vor allem die Roten. Der Handel im eigenen Land lebt vom prickelnden Sekt, während die Stillweine an Nachfrage verlieren. Im Export stagnieren die Erlöse, die Mengen sinken um vier Prozent.
So ruht über der Rekordzahl ein Schatten. Im März 2026 wird die endgültige Bilanz vorliegen – vielleicht wieder nach oben korrigiert, wie schon 2024. Doch selbst wenn der Himmel Italiens Winzern hold bleibt, stellt sich die Frage: Was nützt der beste Jahrgang, wenn der Markt nicht mittrinkt?